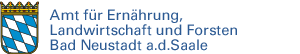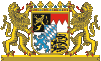Eine Investition, die sich lohnt
Zwischenfruchtanbau in der Region

Zwischenfrüchte werden für Landwirte ein wichtiger Baustein sein, um den modernen Ackerbau nachhaltig und zukunftsfähig zu gestalten. Der Anbau von Zwischenfrüchten nach einer Hauptfrucht im Sommer oder über den Winter bis zum Frühjahr spielt eine immer größere Rolle.
Zwischenfrüchte dienen dem Boden-, Gewässer- und Klimaschutz und fördern Biodiversität. Wir informieren, welche Vorteile Zwischenfrüchte bieten und welchen Herausforderungen sich ein Landwirt beim Anbau stellen muss. Einen Einblick in die Bestände 2020 geben Bilder von den Demonstrationsbetrieben Gewässer-, Boden- und Klimaschutz in Oberstreu und Hammelburg.
Anbau
Vorteile der Zwischenfrucht
- Sie reichern leicht abbaubarer organische Substanzen, in Form von Humus an
- Die Wasserhaltefähigkeit des Bodens wird verbessert
- Durch Bewuchs und Mulch wird der Boden vor Witterungseinflüssen und der Wind- und Wassererosion geschützt
- Stabilisierung des Bodens durch Krümelung (Schattengare), Wurzelmasse und Wurzeltiefgang
- Förderung des Bodenlebens
- Artenreichtum fördert die Biodiversität als Nahrungsquelle, Schutz- und Lebensraum für Insekten und Wildtiere
- Erschließung des Unterbodens und Erhöhung der Wasserinfiltration durch tiefe Durchwurzelung
- Unterdrückung von Unkraut durch Licht-, Wasser- und Nährstoffentzug
- Verbesserung der bodenbiologischen Aktivität und der Selbstreinigungskraft der Fruchtfolge durch Förderung spezifischer Antagonisten von Krankheitserregern
- Auflockern von engen Fruchtfolgen
- Ermöglicht Mulchsaat bei Reihenkulturen wie Mais oder Zuckerrüben
- Biologische Bekämpfung von Rübennematoden und anderen Schaderregern durch den Anbau spezieller Arten und Sorten
- Speicherung von Nährstoffen in der Pflanzenmasse; Erhöhung der Nährstoffverfügbarkeit (besonders für Stickstoff)
- Reduzierung von Phosphatverlusten und damit weniger Eutrophierung von Gewässern
- Verringerung der Nitratauswaschung aufgrund einer Verringerung des Sickerwasseranfalls im Herbst
- Mobilisierung von gebundenem Phosphor
- Abbau von Pflanzenschutzmitteln durch erhöhte bodenbiologische Aktivität.
- Gewinnung von hochwertigem und günstigem Wirtschaftsfutter
- Erzeugung von Biomasse für die Biogasanlage
- Anrechenbar als Greening Fläche (Faktor 0,3)
- Dient der Erfüllung der neuen Auflagen vor Sommerungen in Roten und Gelben Gebieten nach Düngeverordnung
Welche Pflanzen eignen sich und warum?
Als Zwischenfrüchte können die unterschiedlichsten Pflanzen gewählt werden. Dabei sollten die positiven Eigenschaften der einzelnen Pflanzen auf die Ziele abgestimmt und miteinander kombiniert werden.
Kreuzblütler
Einige eignen sich gut für Zuckerrüben- oder Kartoffelfruchtfolgen, da sie der Nematoden Bekämpfung dienen. Allerdings sollten diese nicht in Fruchtfolgen mit Raps stehen, da sie das Risiko einer Infektion mit Kohlhernie fördern.
Abessinischer Kohl, Leindotter und Kresse sind sehr anspruchslos an den Boden, keimen auch bei Trockenheit und können Stickstoff sehr gut über Winter speichern. Sie hinterlassen eine gute Bodengare.
Winterrübsen frieren im Winter nicht ab und speichern den Stickstoff deshalb sehr gut bis ins Frühjahr. Sie sind trockentolerant und haben eine gute Massebildung. Daher eignen sie sich auch zur Futternutzung sehr gut. Im Frühjahr müssen sie allerdings mechanisch oder chemisch abgetötet werden.
Gräser
Sorghum ist als C4 Pflanze wärmebedürftig und besitzt eine gute Trockentoleranz. Unter guten Bedingungen kann sie einen üppigen Massenwuchs haben. Sie friert sicher ab und besitzt einen guten Vorfruchtwert.
Hafer als günstigere Komponente dient in Geteidefruchtfolgen als Gesundungsfrucht, da er die Schwarzbeinigkeit nicht vermehrt. Je nach Sorte ist er universal einsetzbar in Mischungen, konserviert Stickstoff gut und friert sicher ab.
Winterroggen sowie Weidelgräser dienen meist der Erzeugung von hochwertigem Grundfutter im Herbst oder im Frühjahr als GPS vor Mais. Sie sind eine gute Möglichkeit Futterengpässe auszugleichen.
Leguminosen
Unter den Leguminosen gibt es eine Vielzahl verschiedenster Pflanzen von klein- und großkörnigen Arten die zur Verfügung stehen. Zu den Kleearten zählen der Alexandriner-, Perser-, Inkarnat-, Sparriger, Rot-, Weiß-, Schwedenklee sowie die Serradella und noch einige andere. Zu den großkörnigen gehören die Erbsen, Ackerbohnen, Wicken und Lupinen. Die Leguminosen können durch ihre Knöllchenbakterien zusätzlich Stickstoff aus der Luft sammeln und der Folgefrucht zur Verfügung stellen.
Durch Leguminosen können Getreide und Raps Fruchtfolgen aufgelockert werden. In Fruchtfolgen mit Leguminosen sollten sie vorsichtig eingesetzt werden um Fruchtfolgekrankheiten wie z.B. die Kleemüdigkeit vorzubeugen. Die als Hauptfrucht angebaute Leguminose sollte nicht als Zwischenfrucht angebaut werden, um Anbaupausen einzuhalten.
Die verschiedenen Kleearten eignen sich sehr gut als Mischungspartner zur ein- oder mehrschnittigen Futternutzung, sind anspruchslos an den Boden und durchwurzeln diesen gut. Ein feinkrümeliges Saatbeet ist für einen guten Feldaufgang Voraussetzung.
Lupinen und Ackerbohnen durchwurzeln durch ihre Pfahlwurzeln den Boden auch in tieferen Schichten gut, haben in Mischungen eine Stützfunktion und versorgen Mischungspartner mit Stickstoff.
Erbsen und Wicken eignen sich für Mischungen zur GPS oder Futternutzung. Sie haben eine gute Jugendentwicklung und üppiges Wachstum. Sie keimen auch unter trockenen Bedingungen und haben ein gutes Wurzelwachstum was die Bodengare fördert.
Leingewächse, Knöterichgewächse, Wasserblattgewächse
Korbblütler
Das Ramtillkraut ist als Trockenkeimer sehr ansprochslos. Es wurzelt flach, unterdrückt gut Unkraut und hinterlässt eine gute Schattengare. Wie Phacelia auch fördert es die Mykorrhizierung. Bei den ersten Frostanzeichen friert es sicher ab. Da es anfällig für Rhizoctonia und Sclerotinia ist, ist es nicht für Raps-, Zuckerrüben-, Kartoffel- oder Sonnenblumenfruchtfolgen zu empfehlen.
Die Sonnenblume hat geringe Bodenansprüche und einen hohen Wärmebedarf. Sie wurzelt tief wodurch eine gute Gare entsteht. Auch sie fördert die Mykorrhiza Bildung. Sie kann viel Kalium aufnehmen und hat einen guten Vorfruchtwert.
Die Färberdistel oder Saflor ist trockentolerant und wärmeliebend. Sie wächst gut auf gut durchlässigen Böden, kann viele Nährstoffe aufnehmen und an die Folgefrucht weitergeben.
Auswahl geeigneter Mischungen
Geeignete Mischungen und Pflanzen
Folgende Aspekte spielen bei der Wahl von Zwischenfrüchten eine Rolle:
- Welches Ziel möchte ich mit der Zwischenfrucht erreichen?
- Erzeugen von viel organischer Maße zum Aufbau von Humus oder als Mulchschicht für Mulch- und Direktsaat
- Minderung von Wasser- und Winderosion
- Aufnahme und Speicherung von Restmengen Stickstoff im Boden
- Sammeln von Luftstickstoff durch Leguminosen
- Anbau als zusätzliches Futter für Wiederkäuer oder die Biogasanlage
- Aufbrechen von Bodenverdichtungen
- Verwertung von Wirtschaftsdünger im Herbst
- Welchen Aussaatzeitraum habe ich zur Verfügung?
- Vegetationszeit
- Soll die Zwischenfrucht im Winter sicher abfrieren oder winterhart sein?
- Beerntung im Frühjahr?
- Welche Pflanzenarten passen in meine Fruchtfolge?
- Fruchtfolgekrankheiten vermeiden
- Wie viel Aufwand möchte ich in die Aussaat stecken?
- Einfach mit Schneckenkornstreuer und Grubber oder Aufwendig mit der Drillmaschinenkombination
- Soll es eine Einzelkomponente oder eine Mischung aus mehreren Pflanzenarten sein?
- Welche Rolle spielt die Trockenheitstoleranz der Pflanzen auf meinem Standort?
- Soll die Mischung für das Greening zugelassen sein?
Kosten des Anbaus
Beim Zwischenfruchtanbau wird oftmals das Argument gebracht, das dieser nur Geld kostet und nichts einbringt.
Welche Kosten entstehen bei der Aussaat und welchen Gewinn bringt die Zwischenfrucht?
Dabei muss man unterscheiden, ob man den Preis pro Kilogramm Saatgut oder pro Hektar betrachtet. Einzelkomponenten wie z.B. Phacelia haben einen hohen Preis pro Kilogramm, was sie sehr teuer macht. Allerdings liegt die Aussaatstärke in Reinsaat auch nur bei 10 Kg/ha. Je nachdem wie viele und welche Arten von Komponenten in einer Mischung enthalten sind, ist der Kilopreis teurer oder günstiger.
Die Aussaatstärke spielt also eine wichtige Rolle.
| Komponente | Kosten Saatgut in €/kg | Aussaatstärke in kg/ha | Kosten in €/ha |
|---|---|---|---|
| Senf | 2,41 | 20 | 48,2 |
| Phacelia | 8,61 | 10 | 86,1 |
| Geovital MM 200 | 3,31 | 30 | 99,3 |
| TerraLife N-Fixx | 2,56 | 45 | 115,2 |
Die Saatgutkosten liegen bei 45 bis 120 €/ha
Auch die Maschinenkosten für die Aussaat variieren stark je nachdem welches Verfahren man nutzt.
Maschinenkosten (Quelle: Landesanstalt für Landwirtschaft)
- Drillen mit Kreiselegge und Sämaschine 30,50 €/ha Arbeitszeit 0,9 h/ha
- Grubber mit aufgebautem Streuer 16,15 €/ha Arbeitszeit 0,5 h/ha
- Mineraldünger Streuer: 3,56 €/ha Arbeitszeit 0,17 h/ha
- Grubber: 16,08 €/ha Arbeitszeit 0,5 h/ha
- Mulchen: 28,70 €/ha Arbeitszeit 1,09 h/ha
- Walzen: 8,80 €/ha Arbeitszeit 0,34 h/ha
Die Maschinenkosten liegen bei 16 bis 70 €/ha (ohne Lohnkosten).
Die Gesamtkosten für die Aussaat liegen also bei 60 bis 190 €/ha (ohne Lohnkosten).
Dem gegenüber stehen der Ertrag und die Leistung der Zwischenfrucht, die nicht immer auf den ersten Blick zu sehen sind und langfristig betrachtet werden müssen.
Der Wasserberater Rainer Schubert hat bei Nmin- Bodenuntersuchungen in Rhön-Grabfeld und Bad Kissingen festgestellt, das mit Zwischenfrüchten bestellte Ackerflächen über 100 kg Stickstoff im Herbst aus dem Boden aufnehmen und halten können, sodass dieser nicht ausgewaschen wird. Durch den Anbau von Leguminosen wird zusätzlich Stickstoff aus der Luft gesammelt und der Folgekultur zur Verfügung gestellt.
Das heißt: Rechnet man 1 kg Stickstoff mit 1 € so lassen sich bis zu 100 €/ha oder mehr an Düngekosten für die Folgekultur einsparen.
Des Weiteren wird durch den Schutz des Bodens, der Förderung und Steigerung des Bodenlebens und Humusgehaltes, langfristig die Wasserspeicherkapazität des Bodens erhöht. In Trockenperioden halten die Pflanzen länger durch und die Erträge bleiben stabiler.
Zieht man nun von den Kosten die Leistung ab, schrumpfen diese bei ordentlichem Bestand doch deutlich und können sogar zu einem positiven Gewinn führen.
Aussaat
Wie und wann sollte eine Zwischenfrucht ausgesät werden?
Bei der Aussaat von Zwischenfrüchten werden die unterschiedlichsten Varianten praktiziert. Nicht alle eignen sich aber für jede Zwischenfrucht. Wonach richtet sich nun also die Wahl der Saattechnik?
In erster Linie richtet sich die Aussaattechnik nach den Ansprüchen der gewählten Zwischenfrucht. Hierbei spielt die Ablagetiefe eine genauso wichtige Rolle wie bei den Hauptkulturen auch.
Je größer das Saatkorn, desto tiefer kann auch gesät werden.
Bsp.: Ackerbohnen, Erbsen oder auch die Lupine
Diese können sehr tief gesät werden, durch einfaches Aufstreuen und flaches Eingrubbern 4 – 5 cm
Je feiner und kleinkörniger allerdings das Saatgut ist, desto genauer muss die Ablage für einen sauberen Feldaufgang erfolgen.
Bsp.: Kleearten, Phacelia, Leindotter usw.
Diese sollten am besten möglichst exakt mit der Drillmaschine ausgesät werden.
Einige Pflanzenarten wie z.B. der Senf als Lichtkeimer können auch einfach auf den Boden aufgestreut werden und mit einer Walze angedrückt werden.
Bei Eigenmischungen aus grob- und feinkörnigen Saatgütern empfiehlt es sich nach Möglichkeit die Aussaat der Komponenten zu trennen um die Saattiefen optimal einzustellen.
Bsp.: Gemenge aus Erbsen, Hafer und Senf
Die Erbsen mit dem Düngerstreuer auf die Stoppel streuen, und flach eingrubbern, danach im Anschluss direkt das Hafer – Senf – Gemenge mit der Drillkombination aussähen.
Oder Erbsen und Hafer gemeinsam aussähen und danach den Senf oben drauf streuen.
Bei der Aussaat von fertigen Mischungen muss oftmals ein Kompromiss bei der Saattiefe gewählt werden, da die getrennte Aussaat nicht möglich ist. Hier sollten allerdings dann die Feinsämereien in den Vordergrund gestellt werden und die Saattiefe dementsprechend 2 – 3cm nicht überschreiten.
Es sollte auch möglichst die Technik eingesetzt werden, die auf dem Betrieb vorhanden ist oder dem Betrieb einfach und schnell zur Verfügung steht.
Des Weiteren sollte die Schlagkraft der Aussaattechnik bedacht werden, um eventuell enge Zeitfenster optimal zu nutzen.
Daher sollte schon ein Augenmerk auf die Ernte gerichtet werden. Dabei sollte die Stoppel- und Häcksellänge nicht zu lang sein und das Stroh gleichmäßig verteilt oder abgefahren werden um Probleme bei der Saat und dem Feldaufgang zu vermeiden.
Den Aussaat Zeitpunkt einer Zwischenfrucht zu wählen hängt von einigen Faktoren ab.
Möchte man dem Ausfallgetreide keinen Keimvorsprung geben und mögliche Restfeuchte im Boden noch nutzen, so sollte direkt nach der Ernte innerhalb weniger Tage gesät werden.
Müssen Problemunkräuter oder Ausfallgetreide bekämpft werden, sollte eine flache und eine etwas tiefe Bodenbearbeitung vor der Aussaat erfolgen.
Welche Mischung soll gesät werden? Gibt es Komponenten, die zur Samenbildung neigen wenn diese zu früh gesät werden, oder soll die Zwischenfrucht noch zur Futternutzung genutzt werden.
Das Wetter spielt zudem eine Rolle. Zur Aussaat sollte Regen in Sicht sein um einen guten Feldaufgang zu ermöglichen.
Beim Kauf von Mischungen geben die Hersteller immer die Aussaatfenster mit an, nach denen man sich richten kann.
Demonstrationsbetrieb Ludwig Geis, Oberstreu
Die Versuche können eigenständig besucht werden.
Die Versuchsfläche befindet sich von Oberstreu kommend in Richtung Bahra auf der Mönchshofstraße nach dem letzten Gebäude auf der linken Seite.
Von Bahra kommend Richtung Oberstreu auf der rechten Seite vor dem Ortseingang.
Demonstrationsbetrieb Gerhard Fella Hammelburg
Die Versuche können eigenständig besucht werden.
Die Versuchsfläche befindet sich am Betrieb Fella in Hammelburg.
Seeshofer Str. 97
97762 Hammelburg
Ansprechpartner
Lesen Sie hierzu auch
Gewässerschutzberatung am AELF Bad Neustadt
Die Gewässerschutzberatung an unserem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) berät Landwirte zur gewässerschonenden Bewirtschaftung von Acker- und Grünlandflächen und erarbeitet gemeinsam Maßnahmen zum Gewässerschutz in der Region. Mehr